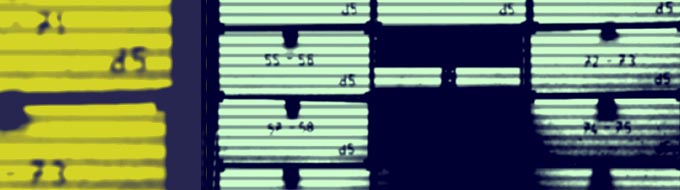Rückblick Symposium »From Archive to Living Database«
 |
Freitag, 24.04.2009
14.00 // »Videokunst per Mausklick« Ein Erfahrungsbericht über den Online-Katalog des IMAI
Dr. Renate Buschmann, Inter Media Art Institute
Der im Internet für jeden zugängliche Online-Katalog ist ein Meilenstein in der Vermittlung von Videokunst. Derzeit sind rund 1.200 audiovisuelle Werke, die zur Sammlung und zum Vertriebsprogramm des imai gehören, in voller Länge online abspielbar. Mit Hilfe der Datenbank kann nach Künstlern, Titeln und Schlagwörtern recherchiert werden. Benutzerfreundliche Zusatzfunktionen wie die Auswahl von Filmsequenzen und Standbildern erleichtern das Studium der Videos. Besonders für Kuratoren, Sammler und Wissenschaftler ist dieser Online-Katalog eine leicht verfügbare Informationsquelle. www.imaionline.de
Die Stiftung imai wurde 2006 auf Initiative der Stadt Düsseldorf und der Kölner Medienkunstagentur 235 Media gegründet und besitzt eine Sammlung von rund 3.200 Videowerken aus der Pionierzeit dieser Kunstgattung, den späten 1960er Jahren, bis in die jüngste Gegenwart. Zu den wesentlichen Zielen des imai zählen die Förderung von Vermittlung und Vertrieb dieses bedeutenden Konvoluts an Videokunst ebenso wie die professionelle Beschäftigung mit Fragen zur Konservierung und Restaurierung von Medienkunst.
Renate Buschmann, promovierte Kunsthistorikerin, arbeitet als Autorin, Lehrbeauftragte und Kuratorin und hat zahlreiche Publikationen zur Kunst des 20./21. Jahrhunderts veröffentlicht. Seit 2008 ist sie am imai – inter media art institute, Düsseldorf, beschäftigt.
 |
15.30 // »Archiv-Interfaces«
Gabriele Blome, Ludwig Boltzmann-Institut Linz
Online-Ressourcen zur Medienkunst bieten den BenutzerInnen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, im Datenbestand zu recherchieren. Die über Websites angebotenen Zugänge basieren nicht einfach auf Datenbankstrukturen, sondern sie sind das Ergebnis eines vielschichtigen Zusammenspiels institutioneller Zielsetzungen, potentieller Benutzeranforderungen und zur Verfügung stehender Ressourcen und Werkzeuge.
Die meisten Archiv-Interfaces stellen Instrumente dar, die gezielte Rechercheinteressen unterstützen. Sie ermöglichen Suchanfragen an den Datenbestand, werten Datenstrukturen aus und repräsentieren diese in unterschiedlichen Darstellungsformen und Navigationsstrukturen.
Darüber hinaus hat sich der Typus des explorativen Interfaces herausgebildet, der das Stöbern im Archiv und das Auffinden von den BenutzerInnen zuvor unbekannten Inhalten unterstützen soll. Solche Archiv-Interfaces sind vor allem für Recherche konzipiert, die nicht in konkreten Suchanfragen beschrieben werden können. Darüber hinaus können sie zusätzliche Einsichten und neue Erkenntnisse vermitteln, die nicht explizit in die Datenbank hineingeschrieben wurden. Was die verschiedenen Archiv-Interfaces leisten und in welchem Verhältnis sie zum Datenbestand bzw. dem jeweiligen institutionellen Kontext stehen, wird anhand verschiedener Beispiele diskutiert.
Der Vortrag basiert auf Forschungen zu Medienkunstarchiven und Visualisierungskonzepten am Ludwig Boltzmann Institut Medien.Kunst.Forschung in Linz (Österreich).
Gabriele Blome ist Kunsthistorikerin und untersucht als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig Boltzmann Institut Medien.Kunst.Forschung. in Linz u.a. das Thema »Online-Ressourcen für die wissenschaftliche Dokumentation und Archivierung von Medienkunst«.
 |
16.00 // »Gaza-Sderot: Das Leben trotz allem«
Osnat Trablesi, Tel Aviv
Gaza liegt in Palästina, Sderot in Israel. Hier leben Männer, Frauen und Kinder unter ständiger Bedrohung durch Bomben, Luftangriffe und Blockaden. Doch trotz dieser schwierigen Bedingungen geht das Leben weiter: Die Menschen arbeiten, lieben und träumen hier genau wie anderswo.
Zwei Monate lang wurde täglich je ein Clip aus Israel und aus Palästina online gestellt, die einander ergänzen, so dass ein umfassendes Bild entstand. Diese duale Sichtweise ist eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der komplexen Realität. Beim Betrachten des einen Videos ist stets auch das andere auf dem Bildschirm präsent und läuft parallel dazu. Tag für Tag wurde so das Alltagsleben in den beiden Städten zeitgleich greifbar gemacht, was dem Internetuser einen ersten, intuitiven Zugang zu dem Thema ermöglichte. WARUM INTERNET? Die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinenser stecken heute in einer Sackgasse, aus der sie nur herauskommen, wenn auch die Bürger in der Öffentlichkeit zu Wort kommen und miteinander kommunizieren können.
Gerade das ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Daher ist ein »neutraler Raum« besonders wichtig, wo jeder Zeugnis ablegen und seine Meinung zum Ausdruck bringen kann. Das Internet ist hierfür besonders gut geeignet.
Osnat Trabelsi ist Koproducer von GAZA / SDEROT Life – despite everything. Trablesi organisierte zahlreiche Veranstaltungen und produzierte zahlreiche Filme und setzt sich für den Dialog zwischen Israel und Palästina ein.
 |
Samstag, 25.04.2009
13.00 // Präsentation mediaartbase.de
Prof. Ludger Brümmer, ZKM | Institut für Musik und Akustik, Instituts- und Projektleiter »mediaartbase.de«
 |
13.30 // »Medienfluss / Media-Flow«
Wolfgang Strauss, Fraunhofer IAIS, netzspannung.org / Medienfluss - Inszenierung eines Archivs im Browser
Was sich in digitalen Archiven verbirgt, wird meist in Listen und karteikartenähnlichen Interfaces dargestellt. So nützlich diese Form für Archivare oder Wissenschaftler sein mag, so wenig inspirierend wirkt sie auf die Benutzer. Der Medienfluss ist ein Browser, der die Inhalte des Archivs der Internetplattform netzspannung.org fließend lesbar macht. Zwei parallele Medienflüsse, einer aus Bildern und einer aus Worten, ziehen am Betrachter vorbei. Im Wortfluss sind die Autoren, Titel und Schlagworte. Im Bilderfluss werden die Bild-Icons der archivierten Dokumente angezeigt.
Bild- und Textfluss starten einen Wahrnehmungs- und Leseprozess, der mit der Auswahl von Begriffen zwischen Peripherie und Zentrum fokussiert. Die Zusammenschau von Übersicht, Kontext und Detail von Informationen ermöglicht eine assoziative Navigation im Archiv, die den klassischen Zugang über Schlagworte mit Ansätzen visueller Orientierung verbindet.
Monika Fleischmann und Wolfgang Strauss sind Research Artists für interaktive Kunst. Sie arbeiten mit begehbaren Wissensräumen und entwerfen Wissenswerkzeuge und Findemaschinen.
fleischmann-strauss.de, http://medienfluss.netzspannung.org/index.html
 |
14.00 // Das Gama-Projekt
Prof. Jean Francois Guiton, Hochschule für Künste Bremen
Das GAMA-Portal bietet eine Fülle von Informationen über die Arbeiten bekannter und junger Medienkünstler aus Europa und dem Ausland. Man kann das Material über Medienkunst aus derzeit acht europäischen Medienkunstarchiven über diese gemeinsame Plattform sichten. Die vorgestellten Kunstprojekte umfassen (Vorschauen von) experimentellen Filmen und Videokunst, Performances, Installationen sowie net.art.
Sie werden mit Hilfe von Texten, Vorlesungen und Events dokumentiert und zusätzlich kontextualisiert. Die Plattform überführt regionale Inhaltsbeschreibungen in eine zentrale Datenbank, wobei die Struktur und die Vollständigkeit der Einzelarchive gewahrt bleibt, die Medienkunst aber beträchtlich vergrößert und dadurch ihre Erkennbarkeit erhöht wird. Visuelle Eigenschaften (wie Farbe, Textur, Bewegung) und auditive Charakteristika (wie Lautstärke) werden in Videos und Bildern automatisch erkannt. Automatische Spracherkennung
Jean-François Guiton, Professor für Neue Medien an der Hochschule für Künste, Bremen, gama-gateway.eu

14.30 // »Musik, das Gedächtnis des Films«
Dr. Achim Heidenreich, ZKM | Institut für Musik und Akustik und Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Musik und (bewegtes) Bild haben ihre eigene Dramaturgie und ihre eigenen Wahrnehmungskriterien. Auf dem gleichen Zeitstrahl simultan gespielt, verbindet beide die Chronologie der Ereignisse. Wenn in einem Hollywood-Film eine Dissonanz erklingt, ist meist Gefahr im Verzug. Dass aber Musik und (bewegtes) Bild auch andere, nämlich aufklärerische Beziehungen miteinander eingehen können, wissen wir spätestens seit Adorno/Eislers Buch über Filmmusik 1947. Der Beitrag beschäftigt sich auf dieser Basis mit neuen dramaturgischen Problemen und Möglichkeiten der Kombination Musik und (bewegtes) Bild in digitaler Zeit.
Achim Heidenreich studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Komparatistik. Seit 2005 am ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Institut für Musik und Akustik, zudem Lehrauftrag für Musikwissenschaft an der Heinrich Heine Universität/Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Seit 2009 Leiter musiktheater intégrale der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (www.hfg.edu/musiktheater).
 |
15.30 // »California Video. Sammlung und Online Recherche«
Glenn R. Phillips, Getty Research Institute Los Angeles
Zwischen 1974 und 1995 führte das Long Beach Museum of Art eine der erfolgreichsten und innovativsten Videokunstabteilungen in den Vereinigten Staaten. Neben einem engagierten Ausstellungs- und Vorführungsprogramm entwickelte das Museum eine Reihe von wichtigen Projekten für die Kabelfernsehübertragungen, unterhielt außerdem noch einen Bereich zur Nachbearbeitung und bot Gastkünstlern Zugang zu Schnittsystemen und -ausrüstung. Im Jahr 2006 erwarb das Getty Research Institute (GRI) das Videoarchiv des Long Beach Museum of Art, das aus fast fünf tausend Bändern besteht. Als eine der größten Kunstbibliotheken der Welt, besitzt das GRI auch Archive von verschiedenen Künstlern oder Gruppen, die für die Geschichte der Video- und Performancekunst von Bedeutung waren, so zum Beispiel die Archive der Experiments in Art and Technology (E.A.T.), Allan Kaprow, Yvonne Rainer, Carolee Schneemann, David Tudor und umfassende Fluxus Sammlungen. Zusammen mit dem Long Beach Archiv verfügt die Mediensammlung des GRI jetzt insgesamt über mehr als 6.000 Titel - die meisten in technisch überholten Formaten. Das GRI hat in eigenen Räumen ein kleines Labor zu Erhaltung der Medien aufgebaut, in dem Audio- und Videoarbeiten gereinigt und digitalisiert werden, damit sie auf Anfrage von Besuchern der Bibliothek angeschaut werden können.
Glenn Phillips, Senior Project Specialist und Consulting Curator am Department of Contemporary Programs and Research am Getty Research Institutet in Los Angeles.
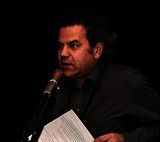 |
16.30 // »Medienkunst braucht Geschichte(n) und Archive!«
Prof. Oliver Grau, Donau-Universität Krems
Trotz gut besuchter Festivals, internationaler Forschung, zahlreichen Artikeln, Konferenzen und datenbankgestützter Dokumentation ist die Medienkunst noch nicht in unserer Gesellschaft angekommen: Sie wird weder systematisch durch Museen und Archive gesammelt, noch von der universitären Kunstgeschichte angemessen berücksichtigt und ist für Kunstinteressierte und Forscher, die nicht aus der nordwestlichen Hemisphäre kommen nur schwer zugänglich. Auf eine in der Kunstgeschichte beispiellose Art und Weise unterliegt Medienkunst der ephemeren Natur der Speichermedien und der permanenten Entwicklung der Technologien, so dass Werke, die vor weniger als zehn Jahren geschaffen wurden, heute in der Regel nicht mehr gezeigt werden können. Wollen wir dieses Erbe nicht vollständig verlieren, müssen wir umgehend handeln und die notwendigen Maßnahmen zu ihrem Erhalt einleiten.
Oliver Grau ist Professor für Bildwissenschaften und Leiter des Departments an der Donau-Universität Krems. Grau war Direktor von Refresh! First International Conference on the Histories of Media Art, Science, and Technology, Banff 2005. Seine Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf die Geschichte von Medienkunst, Immersion und Emotionen sowie auf die Geschichte, Idee und Kultur von Telepresence und Artificial Intelligence. www.mediaarthistory.org